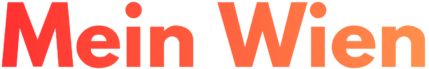In Wien ticken die Uhren für viele ukrainische Flüchtlinge anders als gewohnt. Eine von ihnen ist die 59-jährige Irina aus Charkiw, die vor rund drei Jahren vor dem russischen Angriff auf ihre Heimat fliehen musste. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung als Uhrenhändlerin konnte sie in Wien noch keinen Job finden und lebt von der Grundversorgung, die monatlich nur etwa 400 Euro einbringt. Nach Abzug der Miete für ihr kleines Zimmer bleiben ihr und ihrer Mitbewohnerin lediglich 250 Euro.1 Wie viele andere Ukrainerinnen und Ukrainer hat auch Irina sich bei verschiedenen Lebensmittelketten beworben, jedoch ohne jegliche Rückmeldung. Die Jobsuche gestaltet sich unrentabel – insbesondere für Frauen, die aufgrund von Kinderbetreuung oft kaum die Möglichkeit haben, Vollzeit zu arbeiten.
Ein Blick auf die Zahlen zeigt: In Österreich beträgt die Erwerbsquote unter den ukrainischen Flüchtlingen knapp 50 Prozent. Viele von ihnen arbeiten in den Sektoren Tourismus, Gastronomie, Handel und Gesundheitswesen. Besonders spürbar ist die Problematik für Frauen mit Kindern, die durch die Betreuung nur schwer mehr als Nebenjobs annehmen können.1 Ein weiteres Hindernis stellt die Regelung dar, die es ermöglicht, 110 Euro dazu zu verdienen, wobei 65 Cent pro Euro von der Grundversorgung abgezogen werden. Diese Regelung wird häufig als unzureichend kritisiert, und Experten schlagen vor, die Mindestsicherung als mögliche Lösung zu erwägen.
Hürden auf dem Weg zur Integration
Die Schwierigkeiten bei der Jobsuche fangen jedoch oft schon bei der Anerkennung von Abschlüssen an. Rund 75 Prozent der ukrainischen Vertriebenen verfügen über akademische Abschlüsse, sehen sich aber mit strengen Regelungen zur Anerkennung konfrontiert. So geht es auch Anastasiia Petrenko, die eine Telegram-Gruppe für Mediziner aus ihrer Heimat initiiert hat. Die Gruppe hilft, Kontakte zu knüpfen und sich über Möglichkeiten zur Arbeitsaufnahme auszutauschen.1
Doch der Rückhalt der Behörden ist nicht immer gegeben. In Oberösterreich und Wien gibt es eine Pflicht zur Meldung beim Arbeitsmarktservice (AMS) für ukrainische Flüchtlinge, viele klagen jedoch über unzureichende Unterstützung und mangelhafte Kommunikation seitens der Institutionen. Ein Beispiel dafür ist Oleksandr Nadraha, der gemeinsam mit seiner Familie einen Job gefunden hat, nachdem er intensive Beratungen in Anspruch genommen hatte.1
Die Lage der ukrainischen Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt ist auch in anderen Ländern vergleichbar. In Deutschland etwa haben im November 2024 rund 296.000 geflüchtete Ukrainer eine Beschäftigung gefunden, was lediglich 31,7 Prozent der Arbeitsmarktbeteiligung entspricht. Hier sieht man eine ähnliche Herausforderung: Frauen, die oft alleinerziehend sind, haben seltener Zugang zu festen Arbeitsverhältnissen. Fast 80 Prozent der Flüchtlinge hatten bei ihrer Ankunft keine Deutschkenntnisse, was die Integration zusätzlich erschwert. Doch nach etwa zwei Jahren in Deutschland berichten mehr als die Hälfte, die deutschen Sprachkenntnisse seien gut oder zumindest passabel.23
Der Weg nach vorn
Es bleibt zu hoffen, dass neue Programme wie der „Jobturbo“, der im Herbst 2023 ins Leben rief wurde, die Integration der ukrainischen Flüchtlinge weiter fördern können. Trotz der Herausforderungen zeigen viele engagierte Personen, dass es wichtige Wege zur Schaffung von Chancen gibt. Die bereitwillige Teilnahme an Integrationskursen zeigt, dass diese Menschen bereit sind, sich in ihre neue Heimat zu integrieren und einen positiven Beitrag zu leisten. Ein schnelles Vorankommen in der Beratungs- und Unterstützungsleistung ist dringend notwendig, um den ukrainischen Flüchtlingen eine echte Perspektive zu ermöglichen.3